Mumiengeschichten

Die Vorstellung von Mumien ist mit dem alten Ägypten untrennbar verbunden.
Jahrtausende alte menschliche Körper, das leibhaftige Gegenüber von
Personen, die vor unvorstellbar langer Zeit gelebt haben, haben die Menschen
der Neuzeit seit jeher fasziniert. Mumien sind für Besucher von Ägyptenausstellungen
besonders attraktiv. Horrorfilm und Gruselliteratur haben sich des Mumienthemas
bemächtigt und bezeugen unsere Projektionen archetypischer Angstvorstellungen.
Jeder von uns kennt Boris Karloff als ‚Die Mumie', eine Filmfigur, der die Mumie
Pharao Ramses III. als Vorlage gedient hat.
Was sind Mumien?
Das Wort Mumie kommt aus dem Persischen. Es bezeichnet Bitumen, ein Kohlenwasserstoffprodukt, das im Volksmund auch schwarzes Erdpech genannt wird. Seit dem Mittelalter war der Stoff "Mumia" in Europa bekannt, und zwar erstaunlicherweise als Heilmittel.
Schon im 1. Jahrhundert n. Chr. hat der griechische Arzt Dioskurides aus Kilikien in seiner "Materia medica" das schwarze Erdpech, das er Pissasphalt genannt hat, zur Behandlung von Wunden empfohlen. Dieser Verwendung entsann man sich im Europa der frühen Neuzeit. "Natürliche Mumia" war als Medizin bis ins 18. Jahrhundert sehr beliebt.
Doch Bitumen ist selten. Der Stoff war daher äußerst wertvoll. Wiederholt diente er als Geschenk des persischen Königs an europäische Monarchen. So wurden etwa Ludwig XIV. von Frankreich oder Katharina die Große von Rußland mit dieser Gabe ausgezeichnet.
Mumien als Arzeimittel?
Der Bedarf an Erdpech war immer wesentlich größer als der Vorrat. Schon im 12. Jahrhundert hatte der arabische Arzt Abd al-Latif vorgeschlagen, anstelle des Bitumens die harzähnlichen Substanzen aus dem Inneren einbalsamierter Leichen zu verwenden. Als dies immer noch nicht ausreichte, ging man dazu über, einfach ganze Mumien zu zermahlen. Der französische König Franz I. trug zu Beginn des 16. Jahrhunderts immer einen Beutel zermahlene Mumie bei sich, um gegen Verletzungen gerüstet zu sein.
Im 16. und 17. Jahrhundert führte jede Apotheke, die etwas auf sich hielt, dieses obskure Arzneimittel. Der Handel mit dem Produkt Mumie erfolgte auf den damals üblichen Routen: zumeist von Alexandria ausgeführt, wurde es in Venedig, Lyon oder Marseille umgeschlagen und in die einzelnen europäischen Länder importiert. Waren echte Mumien nicht zur Hand, nahm man eben Fälschungen. In dunklen Gassen orientalischer Bazare gab es geschäftstüchtige Leute, die jüngst Verstorbene in antike Mumien verwandelten.
Nicht nur Europa "profitierte" von Mumien: im 19. Jahrhundert führte ein amerikanischer Papierfabrikant in Maine ägyptische Mumien ein, um aus den Leinenumwicklungen Papier herzustellen.
Aus Aberglauben haben Türken und Araber immer wieder versucht, den Mumienhandel zu unterbinden. Sie verdächtigten die Christen, die Mumien zu essen.
Ob das Medikament "Mumie" je irgendeine Wirkung gezeitigt hat, wurde auch in der Vergangenheit oft bezweifelt. Immerhin: noch im Jahr 1924 führte das Pharmaunternehmen Merck in Darmstadt das Produkt "Mumia vera ägyptica" in seinen Preislisten auf. Es kostete 12 Goldmark pro Kilo.
Mumien als Jahrmarktssensationen
Mumien erfreuten sich nicht nur in Arzneimittelform großer Beliebtheit. Für die Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts waren sie auch eine Sensation an sich. Jedes Raritätenkabinett wollte neben seinen Tanzbären, seinem Flohzirkus und seinen menschlichen Monstern, auch eine richtig gruslige Leiche präsentieren. Viele Europäer hatten die unheimlichen Reisebeschreibungen aus Ägypten gelesen, wo von finsteren Grüften die Rede war, von tanzendem Fackellicht an den Wänden unterirdischer Gräber und uralten Leichnamen. Genau die wollte man nun auch sehen. Gaben die Originale nicht genug her, half man eben ein wenig nach. Im Jahr 1756 berichtet der Graf von Caylus in seinem Werk "Geschichte und Kunst":
"Sie (gemeint sind die Venezianer und die alexandrinischen Juden) haben oft wahren Mumien Puzwerk und Zierathe gegeben, entweder, um die Beschädigungen, die sie erlitten hatten, zu ersetzen, oder um sie mit mehrerem Vortheile los zu werden. Die beyden Mumien, die man in der Bibliothek der Cölestiner verwahrt, sind ein Beweis hiervon. Sie sind alle beyde außer ihren Kisten. Die weibliche ist ganz offen, und man sieht beynahe weiter nichts, als einen trockenen Körper und einen großen Theil harziger Materien nebst überbleibseln von Binden. Inzwischen ist die doch mit Armbändern, mit Ringen an den Beinen, an dem Hals und an den Händen gezieret. Alles dieses ist von vergoldetem Kupfer, und niemals konnten sich dergleichen Zierathen für eine Mumie schicken. ... Die männliche Mumie scheint nicht offen gewesen zu sein: aber wenn man die Natur des Leders untersucht, welches die Maske ausmachet, und die eine Art von Kappe vorstellet, die sie über den Schultern hat; so kann man leicht merken, daß man einen Betrug damit habe spielen wollen."
Balsamierung: von Herodot bis Thomas Mann
Die Begräbnissitten der alten Ägypter waren
seit langem bekannt. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot, der erste
"Ägyptentourist" der Geschichte, hat sie um 450 v. Chr. genau beschrieben.
 "Totenklage
und Begräbnis gehen folgendermaßen vor sich: Wenn in einem Hause ein angesehener
Hausgenosse stirbt, bestreichen sich sämtliche weiblichen Hausbewohner
den Kopf oder auch das Gesicht mit Kot, lassen die Leiche im Hause liegen und
laufen mit entblößter Brust, sich schlagend, durch die Stadt; alle weiblichen
Verwandten schließen sich ihnen an. Auch die Männer schlagen sich und haben
ihr Gewand unter der Brust festgebunden."
"Totenklage
und Begräbnis gehen folgendermaßen vor sich: Wenn in einem Hause ein angesehener
Hausgenosse stirbt, bestreichen sich sämtliche weiblichen Hausbewohner
den Kopf oder auch das Gesicht mit Kot, lassen die Leiche im Hause liegen und
laufen mit entblößter Brust, sich schlagend, durch die Stadt; alle weiblichen
Verwandten schließen sich ihnen an. Auch die Männer schlagen sich und haben
ihr Gewand unter der Brust festgebunden."
Der Leichnam des Verstorbenen wird dann den Balsamierern übergeben. Herodot
schilderte die geschäftliche Seite der Angelegenheit:
 "Hiernach
schreitet man zur Einbalsamierung der Leiche. Es gibt besondere Leute, die dies
berufsmäßig ausüben. Zu ihnen wird die Leiche gebracht, und sie zeigen
nun hölzerne, auf verschiedene Art bemalte Leichname zur Auswahl vor. Wonach
man die vornehmste der Einbalsamierungsarten benennt, scheue ich mich zu sagen.
Sie zeigen dann weiter eine geringere und wohlfeilere und eine dritte, die am
wohlfeilsten ist. Sie fragen dann, auf welche der drei Arten man den Leichnam
behandelt sehen möchte. Ist der Preis vereinbart, so kehren die Angehörigen
heim, und jene machen sich an die Einbalsamierung."
"Hiernach
schreitet man zur Einbalsamierung der Leiche. Es gibt besondere Leute, die dies
berufsmäßig ausüben. Zu ihnen wird die Leiche gebracht, und sie zeigen
nun hölzerne, auf verschiedene Art bemalte Leichname zur Auswahl vor. Wonach
man die vornehmste der Einbalsamierungsarten benennt, scheue ich mich zu sagen.
Sie zeigen dann weiter eine geringere und wohlfeilere und eine dritte, die am
wohlfeilsten ist. Sie fragen dann, auf welche der drei Arten man den Leichnam
behandelt sehen möchte. Ist der Preis vereinbart, so kehren die Angehörigen
heim, und jene machen sich an die Einbalsamierung."
Die Balsamierung für Reiche hat der Schriftsteller Thomas Mann in enger
Anlehnung an Herodot in seinem Josephsroman anschaulich geschildert. "Mumientechniker
und Verewigungskünstler", so schreibt er, ...
"... taten drinnen mit dem Leichnam, was die Brüder nannten: sie salbten
ihn. Aber nicht das war das rechte Wort. Mit einem krummen Eisen zogen sie ihm
das Gehirn durch die Nasenlöcher heraus und füllten die Hirnschale
mit Spezereien. Ein äthiopisches Messerchen, äußerst scharf aus Obsidian,
das sie elegant mit gespreizten Fingern führten, diente ihnen, die linke
Seite des Bauches zu öffnen, daß sie die Eingeweiden entfernten."
 Die
inneren Organe wurden also aus dem Leib herausgenommen und gesondert konserviert.
Man umwickelte sie ebenfalls mit Binden und bestattete sie in vier großen Krügen,
die mit harzigem Salböl aufgegossen wurden. Diese sogenannten Kanopenkrüge
gab man ins Grab, wo sie fürderhin von den vier Söhnen des Gottes
Horus beschützt wurden.
Die
inneren Organe wurden also aus dem Leib herausgenommen und gesondert konserviert.
Man umwickelte sie ebenfalls mit Binden und bestattete sie in vier großen Krügen,
die mit harzigem Salböl aufgegossen wurden. Diese sogenannten Kanopenkrüge
gab man ins Grab, wo sie fürderhin von den vier Söhnen des Gottes
Horus beschützt wurden.
Der Leichnam erfuhr unterdessen ausgeklügelte Behandlung. Dies imaginiert
Thomas Mann:
"Die leere Leibeshöhle spülten sie gründlich mit Dattelwein
und taten statt des Gekröses das Beste hinein, Myrrhe und Würzrinde
von den Wurzelschößlingen eines Lorbeers. Sie taten es mit Handwerksgenuß,
denn der Tod war ihr Kunstgebiet, und sie hatten ihre Freude daran, wie es nun
in des Mannes Leibe so viel reinlicher und appetitlicher aussah als zu Zeit
seiner Beseeltheit. Dann vernähten sie sorglich den Schnitt und legten
den Leichnam in ein Wannenbad von Salpeterlauge für volle siebzig Tage.
Während dieser Zeit feierten sie und aßen und tranken nur, wurden aber
für jede Stunde bezahlt. Als die Badefrist um und der Tote gesalzen, konnte
das Wickeln beginnen, eine bedeutende Arbeit. Byssusbinden, vierhundert Ellen
lang, mit Haftgummi bestrichen, endlose Leinenstreifen, von denen die feinsten
dem Körper am nächsten lagen, wickelten sie ... , immer rundum, bald
neben- und bald übereinander..."
Das Eingewickeltsein erschien den Hinterbliebenen als geradezu trostloser Gegensatz
zu Leben und Beweglichkeit. In einer alten Klage heißt es:
"Weh, wehe, ... ach dieser Verlust! ... Der du so viele Leute hattest, du
bist nun im Lande, das das Alleinsein liebt! Der so gern die Füße öffnete
zum Gehen, der ist nun eingeschlossen, eingewickelt und beengt. Der so viel
feines Leinen hatte und so gern es anlegte, der schläft jetzt in abgelegten
Kleidern von gestern."
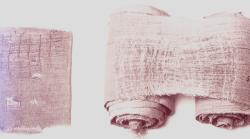 Mumienbinden
wurden aus alten Kleidungsstücken hergestellt. Selbst Königsmumien
sind gelegentlich in wiederverwertete Alttextilien gewickelt. Aus diesen Materialien
lassen sich heute genaü Erkenntnisse über altägyptische Web-,
Näh- und Färbetechniken gewinnen.
Mumienbinden
wurden aus alten Kleidungsstücken hergestellt. Selbst Königsmumien
sind gelegentlich in wiederverwertete Alttextilien gewickelt. Aus diesen Materialien
lassen sich heute genaü Erkenntnisse über altägyptische Web-,
Näh- und Färbetechniken gewinnen.
Viele Menschen konnten sich die Luxusvariante der Einbalsamierung nicht leisten.
Laut Herodot boten sich folgende Alternativen an:
"Wer die Kosten scheut und die mittlere Einbalsamierungsart vorzieht, verfährt
folgendermaßen: man füllt die Klystierspritze mit Zedernöl und führt
das Öl in den Leib der Leiche ein, ohne ihn jedoch aufzuschneiden und die Eingeweide
herauszunehmen. Man spritzt es vielmehr durch den After hinein und verhindert
den Ausfluß. Dann wird die Leiche die vorgeschriebene Anzahl von Tagen eingelegt.
Am letzten Tage läßt man das vorher eingeführte Zedernöl wieder
heraus, das eine so große Kraft hat, daß Magen und Eingeweide aufgelöst
und mit herausgespült werden. Das Fleisch wird durch die Natronlauge aufgelöst,
so daß von der Leiche nur Haut und Knochen übrig bleiben. Danach wird die
Leiche zurückgegeben, und es geschieht nichts weiter mit ihr. Die dritte,
von den ärmeren angewandte Art der Einbalsamierung ist folgende. Der Leib
wird mit Rettigöl ausgespült und die Leiche dann siebzig Tage eingelegt.
Dann wird sie zurückgegeben."
Herodot wies auch auf eine ganz spezielle Gefahr hin:
"Die Frauen angesehener Männer werden nicht gleich nach dem Tode zur
Einbalsamierung fortgegeben, auch schöne oder sonst hervorragende nicht.
Man übergibt sie den Balsamierern erst drei oder vier Tage später;
und zwar geschieht das deswegen, damit sich die Balsamierer nicht an den Fraün
vergehen. Es sei einmal einer wegen der Schändung einer frischen Fraünleiche
bestraft worden, den ein Berufsgenosse angezeigt hatte."
Das Herz
Für den langen, gefahrvollen Weg ins Jenseits mußte der Verstorbene geschützt sein. Der Mumie wurden zahlreiche Amulette beigegeben, je nach Vermögensstand wertvoller oder einfacher. Besonders wichtig war der Herzskarabäus, ein Käfer aus Stein oder Keramik. Das Herz, nach altägyptischem Verständnis Sitz des Verstandes und des Gemüts, hatte die Aufgabe, beim Totengericht über den Charakter und das Verhalten des Toten Rechenschaft abzulegen. Das Herz war das einzige der inneren Organe, das bei der Einbalsamierung im Körper gelassen wurde. Man wollte sichergehen, daß es im entscheidenden Augenblick auch die richtigen Worte fand. Deshalb ritzte man sie auf die Unterseite des Skarabäus.
"O Herz, das ich von meiner Mutter habe, o Herz, das zu meinem Wesen gehört, tritt nicht gegen mich als Zeuge auf, bereite mir keinen Widerstand vor dem Richter, widersetze dich mir nicht vor dem Wägemeister. Du bist mein Geist, der in meinem Leib ist ... sage keine Lügen gegen mich bei dem Gotte."
Als sich während der römischen Kaiserzeit immer mehr Ägypter zum Christentum bekannten, verschwand der Brauch der Mumifizierung. Christen lehnten diese Sitte rundweg ab. So bat der Hl. Antonius um 300 n. Chr. im Hinblick auf seine eigene Bestattung:
"Und so euch an mir gelegen ist und ihr meiner als Vater eingedenk seid, dann erlaubt niemand meinen Leib zu nehmen und nach Ägypten zu bringen, damit sie mich nicht nach ihrem Brauch balsamieren und in ihren Häusern aufbewahren."
Die Religion der Ägypter wurde zu dieser Zeit als heidnisch gesehen. Man wollte sich nicht mehr mit dem religiösen Hintergrund der Mumifizierung beschäftigen. Trotzdem hat noch der Kirchenvater Augustinus teils bewundernd, teils ironisch festgestellt, er glaube, die einzigen, die wirklich an die leibliche Auferstehung glaubten, seien die Ägypter, ...
"... denn sie erhalten die Körper ihrer Toten. Sie pflegen den Brauch, sie zu trocknen, was sie so daürhaft wie Bronze werden läßt."
Der Tod in den ägyptischen Glaubensvorstellungen
Seit der Entzifferung der Hieroglyphen durch den französischen Gelehrten
François Champollion im 19. Jahrhundert hatte sich die Ägyptologie entwickelt.
Archäologen und Ägyptologen lösten die Abenteurer und Schatzsucher
im Nilland ab. Papyri und Inschriften konnten nun gelesen werden, und es eröffnete
sich ein Zugang zur vergessenen Welt des alten Ägypten. Der religiöse
und mythologische Hintergrund der Einbalsamierung wurde erklärt und verstanden.
Ein neür, faszinierender Kosmos von großer Fremdartigkeit und tiefer Religiosität
tat sich auf.
Der Tod bedeutet für den Ägypter nicht das Ende. Die Hoffnung auf ein Weiterleben im gesegneten Jenseits, im "Westen", wo auch die Sonne alltäglich stirbt, gehört zur geistig-religiösen Grundlage eines jeden ägypters. Das Sterben an sich schätzte man dagegen überhaupt nicht.
"Der Tod ist ein unangenehmes Ereignis, eine Qülle der Tränen und des Kummers. Er reißt den Menschen weg von seinem Herd und wirft ihn unter einen Grabhügel im Westen... Niemals mehr wirst du auf die Erde emporsteigen, um das Sonnenlicht zu sehen."
Zwei Konsequenzen zog der Ägypter aus der Unvermeidbarkeit des Todes: er sorgte für das Leben im Jenseits vor, indem er sein Grab, seine "Wohnung für die Ewigkeit" herrichtete. Außerdem versuchte er so intensiv wie möglich zu leben. Diese Haltung drückt die Empfehlung des berühmten "Harfnerliedes" aus.
"Sei fröhlich, daß du das Herz vergessen lassest, daß man dich einst verklären wird. Folge deinem Wunsch, solange du lebst. ... Begehe den Tag fröhlich und werde dessen nicht müde! Siehe, niemand kann seine Habe mit sich nehmen. Siehe, niemand kommt wieder, der fortgegangen ist."
Nach altägyptischer Vorstellung zerfällt der Mensch bei seinem Tod in seine verschiedenen Elemente. Der Körper ist der vergängliche Teil. Ihn aber brauchen die geistigen Bestandteile des Individuums wie Seele, Lebenskraft, Geist und Schatten, um sich im Jenseits wieder zu einer, dem irdischen Leben vergleichbaren Existenz zu vereinigen. Der Körper muß unbedingt erhalten werden, damit er für das jenseitige Leben wiedererweckt werden kann.
"O Verstorbener, dies ist deine Gestalt, in der du auf Erden gewesen bist! Du bist lebendig und verjüngt, Tag für Tag. dein Gesicht ist offen, damit du den Herrn des Horizontes schaust."
Mit diesem Spruch des ägyptischen Totenbuches wird dem Toten sein Leib gezeigt. In der 40. Szene des Pfortenbuches, eines anderen Teils der Jenseitsliteratur, hören wir von der Wiedererweckung der Mumie.
"Erheben soll sich für euch eür Fleisch, zusammenfügen sollen sich für euch eure Knochen, umfassen sollen sich für euch eure Glieder, vereinigen soll sich für euch euer Fleisch!"
Die Zeremonie der Mundöffnung
Während des Begräbnisses wird die Wiederauferweckung der Mumie durch
die Zeremonie der Mundöffnung dargestellt. Der Priester tritt auf die aufrecht
gestellte Mumie zu und spricht:
"Dein Mund war geschlossen, aber ich habe für dich gerichtet deinen
Mund und deine Zähne. Ich öffne für dich deinen Mund, ich öffne
für dich deine beiden Augen. Ich habe deinen Mund geöffnet mit dem
Gerät des Anubis, mit dem Gerät aus Erz, mit dem der Mund der Götter
geöffnet wurde. ... Der Verstorbene soll gehen und sprechen ..."
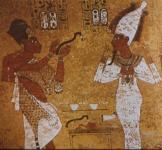 Daraufhin
umarmt der Priester die Mumie und versichert:
Daraufhin
umarmt der Priester die Mumie und versichert:
"Du bist ein Gott unter den Göttern, aber du bist auch zugleich im Besitze
alles dessen, was auf Erden dein eigen war. ... Dein Fleisch blüht und
wächst, dein Blut fließt in den Adern, und alle deine Glieder sind heil
und beweglich. Du hast dein Herz, dein wirkliches früheres Herz!"
Der Tote antwortet:
"Ich bin; ich bin! Ich lebe; ich lebe!"
Grabräuber
Leider wurde die Totenruhe der Verstorbenen seit dem Altertum immer wieder
gestört. Die Fülle der Grabbeigaben, die unermeßlichen Reichtümer
im Tal der Könige stachelten zu allen Zeiten die Habgier der Menschen an.
Selbst die Aussicht, dem Toten höchstpersönlich zu begegnen, hielt
Räuber nicht von ihrer Untat ab. Auch auf Grabwänden eingemeißelte
Fluchformeln, in denen dem Grabräuber beispielsweise angedroht wurde, der
Tote werde ...
"... sein Genick packen und umdrehen wie das einer Gans"
... bewirkten wenig. Zu groß war die Versuchung, sich zu bereichern.
In einem Gerichtsprotokoll aus der Zeit der 20. Dynastie lesen wir das Geständnis
von Grabräubern, die in ein Königsgrab eingedrungen waren.
"Da öffneten wir ihre Särge und die Hüllen, in denen sie lagen.
Wir fanden diese ehrwürdige Mumie dieses Königs ... mit einer langen
Reihe von goldenen Amuletten und Schmucksachen am Hals und den Kopf mit Gold
bedeckt. Die ehrwürdige Mumie dieses Königs war ganz mit Gold überzogen
und seine Sargkasten waren innen und außen mit Gold und Silber bekleidet und
mit allerhand prächtigen Edelsteinen ausgelegt. Wir rissen das Gold ab,
das wir an der ehrwürdigen Mumie dieses Gottes fanden, und ebenso seine
Amulette und Schmucksachen, die an seinem Hals hingen, und die Hüllen,
in denen er ruhte. Die Königin fanden wir ebenso und rissen ebenso alles
ab, was wir an ihr fanden. Ihre Hüllen verbrannten wir, und wir stahlen
auch ihren Hausrat, den wir bei ihnen fanden, an goldenen, silbernen und bronzenen
Gefäßen. Wir teilten dann zwischen uns und teilten dies Gold, das wir bei
diesen Göttern gefunden hatten, an ihren Mumien, den Amuletten, Schmucksachen
und Hüllen in acht Teile."
Bis in unsere Tage werden Gräber geöffnet und die Totenruhe der Verstorbenen
gestört. Heute steht das Interesse der Wissenschaft an erster Stelle.
Mumien und Augräber
 Als
im Jahr 1925 der Sarg des Königs Tut-anch-Amun geöffnet wurde, stand
eine wissenschaftliche Kommission bereit, die Mumie zu untersuchen. Ihr Leiter
Douglas Derry rechtfertigte das Vorgehen.
Als
im Jahr 1925 der Sarg des Königs Tut-anch-Amun geöffnet wurde, stand
eine wissenschaftliche Kommission bereit, die Mumie zu untersuchen. Ihr Leiter
Douglas Derry rechtfertigte das Vorgehen.
"Hier ist vielleicht eine Rechtfertigung gegenüber dem Vorwurf am Platz,
daß wir Tut-anch-Amun enthüllt und untersucht haben. Viele nennen unseren
Eingriff eine Entweihung und meinen, wir hätten den König ruhen lassen
sollen. Aber da das Grab nun einmal gefunden war und Grabräubereien zu
allen Zeiten vorgekommen sind, hätte die Erwartung ungeheurer Reichtümer
in dem Königsgrab den Räubern keine Ruhe gelassen. Der Gedanke, daß
nur einige Fuß unter der Erde ein ungeheurer Schatz verborgen liegt, wäre
zu verlockend gewesen. Selbst das Aufstellen einer starken Wache hätte
Raubversuche nur zeitweise verhindert. Jedes Nachlassen der Wachsamkeit hätte
die Diebe auf den Plan gebracht. Jetzt sind die Gegenstände im Antikenmuseum
geborgen, statt von Dieben und Händlern in alle Erdteile verstreut zu werden.
...
Hätten wir die Mumie nicht ausgewickelt - die Diebe in ihrer Gier nach
Kostbarkeiten wären weniger sorgfältig mit ihr umgegangen, und die
Wissenschaft wäre um die genaü anatomische Untersuchung gebracht worden."
Die Mumie des Tut-anch-Amun ist die einzige der Königsmumien, die noch
heute in ihrem Sarkophag im Grab selbst liegt. Genau von diesem Grab nahm auch
die Legende des sogenannten Fluchs der Pharaonen ihren Ausgang. Man erzählte
sich, der Entdecker des Grabes, Howard Carter, habe ein Tontäfelchen gefunden,
worauf einem Eindringling in das Grab angedroht wurde, "der Tod werde auf schnellen
Schwingen zu ihm kommen." Merkwürdigerweise ist dieses Täfelchen verschollen,
und man darf mit Fug und Recht bezweifeln, ob es je existiert hat. Dennoch:
die Legenden vom Fluch der Pharaonen hielten sich hartnäckig, gefördert
und ausgeschmückt von Journalisten, die genau wußten, welche Gruselgeschichten
ihre Leser liebten. Ganz bewußt wurden Unwahrheiten gedruckt, um Auflagen zu
steigern. So hieß es über die Untersuchung der Mumie Tut-anch-Amuns:
"Die Obduktion ... hatte tragische Folgen. Alfred Lucas (der Chemiker der
Altertümerverwaltung) erlag bald darauf einem Herzanfall. Wenig später
starb Prof. Derry, der den ersten Schnitt an der Mumie Tut-anch-Amuns ausgeführt
hatte, an Kreislaufversagen."
Wenn hier ein Fluch der Auslöser der Todesfälle war, dann handelte
es sich um einen Fluch mit Langzeitwirkung. Die Mumie Tut-anch-Amuns wurde am
11. November 1925 untersucht. Alfred Lucas starb 1945, Douglas Derry gar erst
1961 als betagter Mann von 87 Jahren.
Ob Fluch oder nicht: Mumien waren eines der interessantesten Kapitel der Ausgrabungsgeschichte
in Ägypten. Einer der frühen Entdecker, der Abenteurer Giovanni Belzoni,
beschieb die Entdeckung eines Grabes, das mehrere Mumien enthielt.
"Aber was für ein Ruheplatz! Umgeben von Toten, von Haufen von Mumien
an allen Seiten ... Das Schwarz der Wand, der wegen des Saürstoffmangels
nur schwache Schein der Kerzen und Fackeln, die verschiedenen Gegenstände
um mich herum, die miteinander zu sprechen schienen, und die Araber mit den
Kerzen und Fackeln in Händen, nackt und staubbedeckt und selber wie lebende
Mumien, dies alles gab ein unbeschreibliches Bild. ... (Ich suchte mir) einen
Ruheplatz, fand einen und wollte mich setzen, aber als mein Gewicht auf dem
Körper eines ägypters lastete, wurde dieser eingedrückt wie eine
Hutschachtel. Natürlich hätte ich mein Gewicht mit den Händen
abstützen können, aber auch sie fanden keinen besseren Halt; so versank
ich also unter dem Knirschen von Knochen, Lumpen und hölzernen Behältern
völlig in den zerbrochenen Mumien, und es erhob sich ein solcher Staub,
daß ich eine Viertelstunde still liegen bleiben mußte, bis er sich wieder gelegt
hatte."
Die Entdeckung der Königsmumien
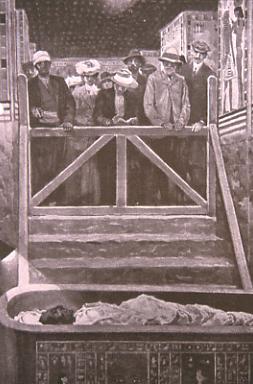 Der
sensationellste Mumienfund ereignete sich im Jahr 1881. Zu diesem Zeitpunkt waren
schon seit Jahren im Antikenhandel in Kairo immer wieder wertvolle Grabbeigaben
und Papyri ungeklärter Herkunft aufgetaucht. Der damalige Leiter der ägyptischen
Antikenverwaltung, Gaston Maspero, veranlaßte eine Untersuchung. Die Spur führte
in das oberägyptische Luxor. Im Dorf Kurna auf dem Westufer des Nil wohnte
die Familie Abd-er-Rassul. Sie lebte vom Grabraub, wie die meisten Dorfbewohner.
Verhöre, bei denen sogar Prügel angewendet wurden, zwangen die Familienmitglieder
schließlich, das Versteck preiszugeben, aus dem die Gegenstände stammten.
Die Männer führten Masperos Assistenten, den Deutschen Emil Brugsch,
zum Grab einer Königin aus der 17. Dynastie. Die Grabanlage befand sich in
einer Felswand südlich von Deir el-Bahari. Schächte und Stollen führten
in einen 80 m langen Raum. Als Emil Brugsch und seine Leute die Lampen hoben und
den Raum ausleuchteten, konnten sie kaum fassen, worauf sie gestoßen waren. Vor
ihnen lagen die Mumien der berühmtesten Pharaonen der Geschichte. Sie befanden
sich in einem Sammelversteck, das Priester um 1000 v. Chr. eingerichtet hatten,
um die Leiber der Könige vor den allgegenwärtigen Grabräubern zu
retten. Gaston Maspero hat später diese unglaubliche Entdeckung beschrieben.
Der
sensationellste Mumienfund ereignete sich im Jahr 1881. Zu diesem Zeitpunkt waren
schon seit Jahren im Antikenhandel in Kairo immer wieder wertvolle Grabbeigaben
und Papyri ungeklärter Herkunft aufgetaucht. Der damalige Leiter der ägyptischen
Antikenverwaltung, Gaston Maspero, veranlaßte eine Untersuchung. Die Spur führte
in das oberägyptische Luxor. Im Dorf Kurna auf dem Westufer des Nil wohnte
die Familie Abd-er-Rassul. Sie lebte vom Grabraub, wie die meisten Dorfbewohner.
Verhöre, bei denen sogar Prügel angewendet wurden, zwangen die Familienmitglieder
schließlich, das Versteck preiszugeben, aus dem die Gegenstände stammten.
Die Männer führten Masperos Assistenten, den Deutschen Emil Brugsch,
zum Grab einer Königin aus der 17. Dynastie. Die Grabanlage befand sich in
einer Felswand südlich von Deir el-Bahari. Schächte und Stollen führten
in einen 80 m langen Raum. Als Emil Brugsch und seine Leute die Lampen hoben und
den Raum ausleuchteten, konnten sie kaum fassen, worauf sie gestoßen waren. Vor
ihnen lagen die Mumien der berühmtesten Pharaonen der Geschichte. Sie befanden
sich in einem Sammelversteck, das Priester um 1000 v. Chr. eingerichtet hatten,
um die Leiber der Könige vor den allgegenwärtigen Grabräubern zu
retten. Gaston Maspero hat später diese unglaubliche Entdeckung beschrieben.
"Man konnte nur kriechend weiter kommen, ohne zu wissen, wohin man Hände
und Füße setzen sollte. Die Särge und Mumien, in der Eile nur flüchtig
beim Schein einer Kerze besichtigt, trugen historische Namen: Amenophis I., Thutmosis
II., in der Nische nahe an der Treppe Ahmose I. und sein Sohn Siamun, Seqenen-Re,
die Königin Ahhotep, Ahmes-Nofretari und andere. Hinten im Zimmer erreichte
das Durcheinander den höchsten Grad aber man konnte auf den ersten Blick
das Vorherrschen des der 20. Dynastie eigenen Stils erkennen. Die Meldung des
Mohamed Achmed Abd-er-Rassul, welche anfangs übertrieben schien, war nur
ein schwacher Ausdruck der Wahrheit: wo ich ein oder zwei unbedeutende Könige
zu finden erwartete, hatten die Araber ein ganzes Grabgewölbe von Pharaonen
aufgestöbert. Und was für Pharaonen! Vielleicht die berühmtesten
der ägyptischen Geschichte, Thutmosis III. und Sethos I., Ahmose, der Befreier
und Ramses II., der Eroberer. Herr Emil Brugsch glaubte, das Spiel eines Traumes
zu sein, als er unverhofft in solche Gesellschaft geriet, und ich frage mich noch,
wie er, ob ich wirklich nicht träume, wenn ich das sehe und mit den Händen
greife, was einst der Leib so vieler bedeutender Männer war..."
Während des Transports der Königsmumien in das Museum von Boulaq, das
spätere ägyptische Museum von Kairo, ereignete sich etwas sehr Eigenartiges.
"Am 11. Juli abends waren endlich alle Mumien und Särge in Luxor, gehörig
verpackt in Matten und Tücher. Drei Tage später kam der Museumsdampfer;
nachdem er eben beladen war, kehrte er mit seiner Fracht an Königen nach
Boulaq zurück. Merkwürdig! Von Luxor bis Quust folgten die Fellachenweiber
mit aufgelösten Haaren heulend dem Schiff an beiden Ufern des Nil und die
Männer schossen mit ihren Flinten, wie sie das bei Begräbnissen zu thun
pflegen."
Angesichts dieses aufregenden Fundes ist es nicht verwunderlich, wenn Ausgräber
in den folgenden Jahren hofften, auf ein weiteres Versteck von Königsmumien
zu stoßen.
1898 war es soweit. Victor Loret, ein französischer Ägyptologe, entdeckte
das Grab Amenophis II. Dieses Grab war gleich mehrfach bewohnt.
"Ich ging mit meiner Kerze vorwärts und - welch gräßlicher Anblick!
- da lag ein Körper auf einem Boot, schwarz und häßlich, das Gesicht
mit einer Grimasse mir zugewandt. Er starrte mich an. ... Einen Moment war mir
nicht klar, daß es sich hier um eine ausgewickelte Mumie handelte. ... War dies
ein Menschenopfer? Oder ein Grabräuber, ermordet von seinen Komplizen ...?"
Wie sich später herausstellte, war die Mumie eines Prinzen ausgeraubt worden,
noch bevor die Salböle ganz getrocknet waren. Die Grabräuber hatten
den Leichnam achtlos auf das Modellboot geworfen, wo sie dann festklebte.
Die Mumie des Pharao Amenhotep II. lag noch in ihrem Sarkophag. Schon das war
eine echte Sensation! Doch dann fand Loret eine fast ganz zugemaürte Seitenkammer.
Sie wurde geöffnet, und der Archäologe stand erschüttert vor der
Entdeckung seines Lebens. Acht Pharaonen lagen vor ihm: Thutmosis IV., Amenophis
III., Merenptah, Siptah, Sethos II., Ramses IV., Ramses V., und Ramses VI. Das
zweite große Sammelversteck war gefunden! Per Schiff wurden die Könige nach
Kairo gebracht.
Bei der Untersuchung im ägyptischen Museum stellte man fest, daß sich die
Königsmumien teilweise in einem beklagenswert ramponierten Zustand befanden.
Diebe hatten sie auf der Suche nach Kostbarkeiten schwer beschädigt. Die
Mumienspezialistin Dr. Renate Germer schreibt:
"Besonders schlimm erging es Ramses VI. Die Grabräuber hatten seine Mumie
buchstäblich zerhackt, die Gliedmaßen vom Körper getrennt und den Kopf
gespalten. Beim erneuten Einwickeln legten die Priester die Reste auf ein Brett
und aus Versehen sogar noch Teile von zwei weiteren Individün mit hinzu,
die Hand einer Frau und den Unterarm mit Hand eines anderen Mannes."
Das Who's who der Königsmumien
Die Identifizierung der einzelnen Pharaonen ist nicht immer zweifelsfrei
möglich. Die Mumien lagen nicht mehr in ihren ursprünglichen Särgen,
die Aufschriften auf den Mumien selbst stimmten oft nicht mit denen auf den Särgen
überein. Ein besonders krasses Beispiel nennt Frau Dr. Germer:
"So befand sich die als ‚Amenophis III.' beschriftete Mumie in einem Sargunterteil,
das den Namen ‚Ramses III.' trug, mit einem Sargdeckel, der mit dem Namen ‚Sethos
II.' und einer zusätzlichen Tinteninschrift ‚Amenophis III." versehen war."
Die heute zur Verfügung stehenden technischen Mittel erlauben eine sehr genaü
medizinische Untersuchung der Leichname. Das vergrößert die Verwirrung über
die tatsächliche Identität der Mumien. So kann das ungefähre Sterbealter
der Könige bestimmt werden, das sich oft nicht mit den aus historischen Qüllen
erschlossenen Regierungsjahren deckt. Der Vergleich der Schädelformen und
Knochenstruktur läßt Rückschlüsse auf den Grad der Verwandtschaft
zu, und der entspricht vielfach nicht der bislang angenommenen Identifikation.
Das "Who is Who" unter den Königsmumien ist Gegenstand kontroverser Debatten,
die in der Fachliteratur und heute sogar im Internet geführt werden.
Mumien als Datenlieferanten
Röntgendiagnostik, Computertomographie und moderne chemische Analyseverfahren
erlauben heute Rückschlüsse auf Ernährung und Krankheiten der
Verstorbenen. Wir lesen, daß die alten Ägypter an Bilharziose erkrankten
und von Parasiten gepeinigt wurden. König Merenptah hat in seinen letzten
Jahren an schwerer Arthrose, Arteriosklerose und an schmerzhaften Zahnabszessen
gelitten, wie viele seiner Zeitgenossen. Es hat Lepra gegeben und wahrscheinlich
auch Pocken. Die Staublunge wurde an einer Mumie nachgewiesen; vom stark verkrüppelte
Fuß des Pharao Siptah kann man auf das Vorkommen von Kinderlähmung schließen.
Der Nachweis von bestimmten Trichinen in einer Mumie ist der Beweis, daß die
Ägypter gern Schweinefleisch gegessen haben.
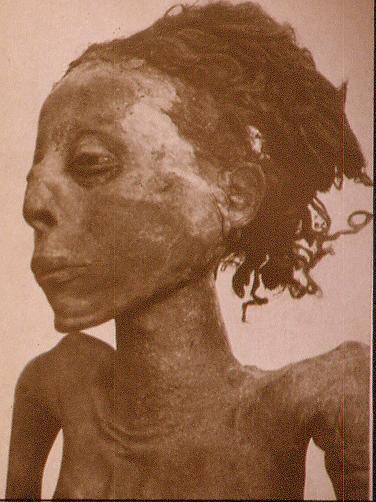 Mumien
geben eine Fülle von Hinweisen auf Lebens- und Umweltbedingungen im alten
Ägypten. Moderne Computertechnik eröffnet die Möglichkeit, das
ursprüngliche Aussehen der Menschen zu rekonstruieren. In den achtziger
Jahren ist es sogar gelungen, Teile der DNA, der genetischen Erbinformation
einer ägyptischen Mumie zu isolieren und zu reproduzieren.
Mumien
geben eine Fülle von Hinweisen auf Lebens- und Umweltbedingungen im alten
Ägypten. Moderne Computertechnik eröffnet die Möglichkeit, das
ursprüngliche Aussehen der Menschen zu rekonstruieren. In den achtziger
Jahren ist es sogar gelungen, Teile der DNA, der genetischen Erbinformation
einer ägyptischen Mumie zu isolieren und zu reproduzieren.
Mumien mögen heute in erster Linie Datenlieferanten für die Wissenschaft
sein. Doch vergessen wir nicht: für die alten Ägypter sind sie der
Ort, wohin Seele und Lebenskraft zurückkehren, die große Hoffnung für
die Zeit nach dem Tod
"Ein schönes Begräbnis, möge es in Frieden kommen, wenn deine
70 Tag in deiner Leichenhalle vollendet sind, und du auf den Katafalk gelegt
bist. Du wirst von frischen Stieren gezogen, und die Wege sind mit Milch besprengt,
bis du den Eingang deines Grabes erreichst. Die Kinder deiner Kinder, alle vereint,
sie weinen mit sehnendem Herzen. ... Deine Glieder und deine Knochen sind vollständig,
wie es dir zukommt. Dir werden Verklärungssprüche vorgelesen, und
das königliche Totenopfer wird an dir vollzogen. Dein Herz ist bei dir,
wie es richtig ist. ... Du kommst in deiner früheren Gestalt wie am Tage,
an dem du geboren wurdest."
Mumie der Priesterin Nesitanebascheru
Spätzeit, 23. Dyn.
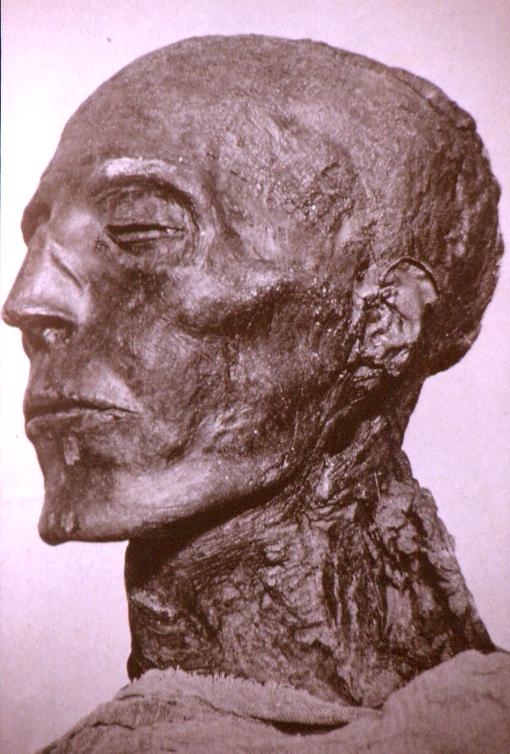

 "Hiernach
schreitet man zur Einbalsamierung der Leiche. Es gibt besondere Leute, die dies
berufsmäßig ausüben. Zu ihnen wird die Leiche gebracht, und sie zeigen
nun hölzerne, auf verschiedene Art bemalte Leichname zur Auswahl vor. Wonach
man die vornehmste der Einbalsamierungsarten benennt, scheue ich mich zu sagen.
Sie zeigen dann weiter eine geringere und wohlfeilere und eine dritte, die am
wohlfeilsten ist. Sie fragen dann, auf welche der drei Arten man den Leichnam
behandelt sehen möchte. Ist der Preis vereinbart, so kehren die Angehörigen
heim, und jene machen sich an die Einbalsamierung."
"Hiernach
schreitet man zur Einbalsamierung der Leiche. Es gibt besondere Leute, die dies
berufsmäßig ausüben. Zu ihnen wird die Leiche gebracht, und sie zeigen
nun hölzerne, auf verschiedene Art bemalte Leichname zur Auswahl vor. Wonach
man die vornehmste der Einbalsamierungsarten benennt, scheue ich mich zu sagen.
Sie zeigen dann weiter eine geringere und wohlfeilere und eine dritte, die am
wohlfeilsten ist. Sie fragen dann, auf welche der drei Arten man den Leichnam
behandelt sehen möchte. Ist der Preis vereinbart, so kehren die Angehörigen
heim, und jene machen sich an die Einbalsamierung." Die
inneren Organe wurden also aus dem Leib herausgenommen und gesondert konserviert.
Man umwickelte sie ebenfalls mit Binden und bestattete sie in vier großen Krügen,
die mit harzigem Salböl aufgegossen wurden. Diese sogenannten Kanopenkrüge
gab man ins Grab, wo sie fürderhin von den vier Söhnen des Gottes
Horus beschützt wurden.
Die
inneren Organe wurden also aus dem Leib herausgenommen und gesondert konserviert.
Man umwickelte sie ebenfalls mit Binden und bestattete sie in vier großen Krügen,
die mit harzigem Salböl aufgegossen wurden. Diese sogenannten Kanopenkrüge
gab man ins Grab, wo sie fürderhin von den vier Söhnen des Gottes
Horus beschützt wurden.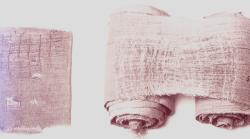 Mumienbinden
wurden aus alten Kleidungsstücken hergestellt. Selbst Königsmumien
sind gelegentlich in wiederverwertete Alttextilien gewickelt. Aus diesen Materialien
lassen sich heute genaü Erkenntnisse über altägyptische Web-,
Näh- und Färbetechniken gewinnen.
Mumienbinden
wurden aus alten Kleidungsstücken hergestellt. Selbst Königsmumien
sind gelegentlich in wiederverwertete Alttextilien gewickelt. Aus diesen Materialien
lassen sich heute genaü Erkenntnisse über altägyptische Web-,
Näh- und Färbetechniken gewinnen.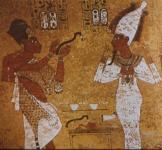
 Als
im Jahr 1925 der Sarg des Königs Tut-anch-Amun geöffnet wurde, stand
eine wissenschaftliche Kommission bereit, die Mumie zu untersuchen. Ihr Leiter
Douglas Derry rechtfertigte das Vorgehen.
Als
im Jahr 1925 der Sarg des Königs Tut-anch-Amun geöffnet wurde, stand
eine wissenschaftliche Kommission bereit, die Mumie zu untersuchen. Ihr Leiter
Douglas Derry rechtfertigte das Vorgehen.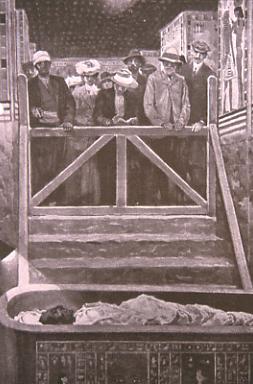 Der
sensationellste Mumienfund ereignete sich im Jahr 1881. Zu diesem Zeitpunkt waren
schon seit Jahren im Antikenhandel in Kairo immer wieder wertvolle Grabbeigaben
und Papyri ungeklärter Herkunft aufgetaucht. Der damalige Leiter der ägyptischen
Antikenverwaltung, Gaston Maspero, veranlaßte eine Untersuchung. Die Spur führte
in das oberägyptische Luxor. Im Dorf Kurna auf dem Westufer des Nil wohnte
die Familie Abd-er-Rassul. Sie lebte vom Grabraub, wie die meisten Dorfbewohner.
Verhöre, bei denen sogar Prügel angewendet wurden, zwangen die Familienmitglieder
schließlich, das Versteck preiszugeben, aus dem die Gegenstände stammten.
Die Männer führten Masperos Assistenten, den Deutschen Emil Brugsch,
zum Grab einer Königin aus der 17. Dynastie. Die Grabanlage befand sich in
einer Felswand südlich von Deir el-Bahari. Schächte und Stollen führten
in einen 80 m langen Raum. Als Emil Brugsch und seine Leute die Lampen hoben und
den Raum ausleuchteten, konnten sie kaum fassen, worauf sie gestoßen waren. Vor
ihnen lagen die Mumien der berühmtesten Pharaonen der Geschichte. Sie befanden
sich in einem Sammelversteck, das Priester um 1000 v. Chr. eingerichtet hatten,
um die Leiber der Könige vor den allgegenwärtigen Grabräubern zu
retten. Gaston Maspero hat später diese unglaubliche Entdeckung beschrieben.
Der
sensationellste Mumienfund ereignete sich im Jahr 1881. Zu diesem Zeitpunkt waren
schon seit Jahren im Antikenhandel in Kairo immer wieder wertvolle Grabbeigaben
und Papyri ungeklärter Herkunft aufgetaucht. Der damalige Leiter der ägyptischen
Antikenverwaltung, Gaston Maspero, veranlaßte eine Untersuchung. Die Spur führte
in das oberägyptische Luxor. Im Dorf Kurna auf dem Westufer des Nil wohnte
die Familie Abd-er-Rassul. Sie lebte vom Grabraub, wie die meisten Dorfbewohner.
Verhöre, bei denen sogar Prügel angewendet wurden, zwangen die Familienmitglieder
schließlich, das Versteck preiszugeben, aus dem die Gegenstände stammten.
Die Männer führten Masperos Assistenten, den Deutschen Emil Brugsch,
zum Grab einer Königin aus der 17. Dynastie. Die Grabanlage befand sich in
einer Felswand südlich von Deir el-Bahari. Schächte und Stollen führten
in einen 80 m langen Raum. Als Emil Brugsch und seine Leute die Lampen hoben und
den Raum ausleuchteten, konnten sie kaum fassen, worauf sie gestoßen waren. Vor
ihnen lagen die Mumien der berühmtesten Pharaonen der Geschichte. Sie befanden
sich in einem Sammelversteck, das Priester um 1000 v. Chr. eingerichtet hatten,
um die Leiber der Könige vor den allgegenwärtigen Grabräubern zu
retten. Gaston Maspero hat später diese unglaubliche Entdeckung beschrieben.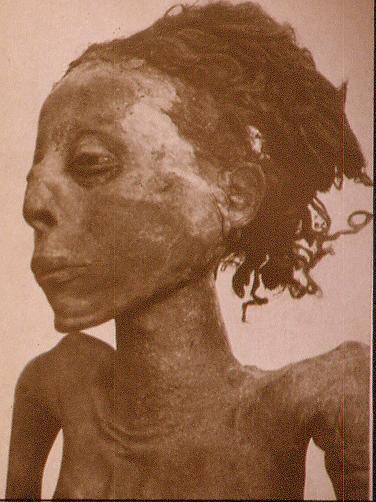 Mumien
geben eine Fülle von Hinweisen auf Lebens- und Umweltbedingungen im alten
Ägypten. Moderne Computertechnik eröffnet die Möglichkeit, das
ursprüngliche Aussehen der Menschen zu rekonstruieren. In den achtziger
Jahren ist es sogar gelungen, Teile der DNA, der genetischen Erbinformation
einer ägyptischen Mumie zu isolieren und zu reproduzieren.
Mumien
geben eine Fülle von Hinweisen auf Lebens- und Umweltbedingungen im alten
Ägypten. Moderne Computertechnik eröffnet die Möglichkeit, das
ursprüngliche Aussehen der Menschen zu rekonstruieren. In den achtziger
Jahren ist es sogar gelungen, Teile der DNA, der genetischen Erbinformation
einer ägyptischen Mumie zu isolieren und zu reproduzieren.